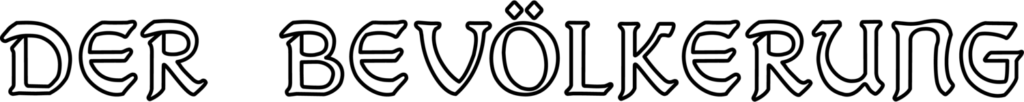Hans Haacke:
In meiner Replik auf Martin Warnke in der Süddeutschen Zeitung habe ich an den Gemeinplatz der Geistes- und Sozialwissenschaften erinnert, dass, wenn man nicht zu falschen Schlüssen kommen will, bei allen Interpretationen der historische Kontext des zu interpretierenden Forschungsgegenstandes zu berücksichtigen ist. Das Wort “Volk” ist in Deutschland bekanntlich nicht wie in anderen Ländern, die unter ganz anderen Bedingungen und in einem viel längeren Prozess eine nationale Identität entwickelt haben, mit primär republikanischen Konnotationen besetzt. Der Volksbegriff ist bei uns schillernd, sowohl sehr positiv wie äusserst negativ aufgeladen. Besonders ist das in der Kombination mit dem Adjektiv “deutsch” der Fall. Dazu etwas Ortsspezifisches: die Nationalsozialisten haben 113 Reichstagsabgeordneten ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volk aberkannt. 75 der Ausgebürgerten überlebten die Haft nicht, acht verübten Selbstmord. Zwei Söhne der jüdischen Bronzegiesser, der Brüder Siegfried und Albert Loevy, die auf Geheiss des Kaisers zur Stärkung der Kampfmoral im 1. Weltkrieg die Inschrift DEM DEUTSCHEN VOLKE für den Reichstagsgiebel hergestellt hatten, sind im Namen des deutschen Volkes ermordet worden (es ist interessant, dass ausgerechnet diese ortsspezifischen Informationen von den Herausgebern der FAZ aus einem Leserbrief von mir gestrichen worden sind). Die Verheerungen, die mit dem Wortpaar ausserhalb des Reichstagsgebäudes verbunden waren, brauche hier nicht zu rekapitulieren. Dieses verbrecherische Kapitel der deutschen Geschichte gehört zu unserer nationalen Identität genauso wie nach 1945 die Schaffung einer stabilen demokratischen Gesellschaft und die emanzipatorischen Volksaufstände von 1953 und 1989 in der DDR, auf die wir stolz sein können.
Obgleich ich dem Argument nicht folgen kann, habe ich Verständnis für den Einwand, der Revolutionsruf “Wir sind das Volk” von 1989, erlaube uns, nun wie andere Länder unbefangen mit dem Volksbegriff umzugehen. Erinnern wir uns aber an die historische Situation! Der Nachdruck lag 1989 auf dem Wort “wir.” Die Bevölkerung (!) der DDR erinnerte ihre Oberen daran, dass deren penetrante Identifikation mit dem Volk jeder Legitimation entbehrte. Sie schleuderten dem verhassten Regime sozusagen die ideologische Handgranate zurück, die ihnen eigentlich gegolten hatte. An deutsches “Volkstum” dachten sie nicht. Sie handelten vielmehr in der Tradition der Französischen Revolution, von der auf unserem Kontinent alle demokratischen Bewegungen inspiriert worden sind. Mit der Parole Liberté, Égalité, Fraternité hatten die Franzosen als Erste den republikanischen Volkssouverän. le peuple, inthronisierte. Das Volk in diesem Sinne, das sind wir alle – und zwar ohne Unterschied!
Es wird in der Bundesrepublik aber immer noch unterschieden. Trotz des Artikels 3 des Grundgesetzes (“Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden”) in dem die Gleichheit aller Menschen garantiert wird, geistert das ausgrenzend “Völkische” weiter in den Köpfen. Daran hat der Ruf “Wir sind das Volk!” in der DDR nichts geändert. Immer wieder hören wir von Überfällen auf Menschen, die den Vorstellungen der Schläger vom rechten “Deutschtum” nicht entsprechen. Anschläge auf Synagogen und Häuser, in denen Ausländer wohnen. nehmen kein Ende. Rechtsradikale berufen sich bei ihren Gewalttaten auf ein blutsmässig definiertes deutsches Volk. Die Inschrift auf dem Reichstagsgebäude sperrt sich gegen eine solche, deutschnational exklusive Interpretation nicht. Zu meinem Projekt erhielten die Bundestagsabgeordneten haufenweise Briefe, aus denen sie unmissverständlich dumpfe Ressentiments vernahmen. Frau Süssmuth warnte in ihrer Rede: “Diese Minderheit hebt kräftig an und wirft den noch Mächtigen vor, sie seien für die Milliardenbeiträge an Sozialhilfe, die für Ausländer und Asylsuchende, die hier nicht hingehören, zahlen müssen, verantwortlich. Ich muss nicht Namen nennen, weil es Grundtenor nicht nur einzelner Briefe, sondern Hunderter Briefe ist. Weiter wird gefragt, ob diejenigen, die zugestimmt hätten [zu meinem Projekt für das Reichstagsgebäude] nicht sowieso geisteskrank oder von allen guten Geistern verlassen seien. Es wird gefragt: Sollen die Gelben, die Schwarzen, die Türken und die Zigeuner auch dazu gehören? Das wäre der Verrat am Vaterland.” – Frau Süssmuth schlug deshalb vor: “Es wäre gut, wenn all die Briefe, die viele von uns bekommen haben, bei einer Ablehnung des Projekts als Dokumentation an den leeren Platz des nördlichen Lichthofes gelegt würden.”
Zu unserer Gegenwart gehört aber auch, dass die Wirtschaft schon seit Jahren nicht mehr in “national”-ökonomischen Kategorien operiert, dass die europäische Integration auf allen Ebenen zunimmt – auch im persönlichen Leben – und dass wir zunehmend global denken wollen oder müssen. Es ist rührend zu beobachten, wie Bundestagsabgeordnete sich angesichts dieser Entwicklung in einer Festung Deutschland verschanzen wollen . Der FDP-Abgeordnete Heinrich erinnerte seine Kollegen, dass in der Bundesrepublik heute etwa 10 Millionen Menschen ohne deutschen Pass leben. Das ist der Kontext, in dem die Inschrift über dem Westportal des Reichstages und meine Widmung DER BEVÖLKERUNG als sich ergänzendes Paar zu verstehen sind.
Interview
Und noch einmal zur “Mutter Erde.” Für den Gott des Alten Testamentes stand die von ihm geschaffene Erde für die “irdische” Welt schlechthin. Heute dominiert die Fruchtbarkeit des Bodens das Warentermingeschäft. Dass die Nationalsozialisten das altbewährte Material während ihrer zwölfjährigen Herrschaft – wie so vieles – in ihre ideologischen Dienste gepresst haben, verwundert nicht. Geblieben ist davon praktisch nichts. Bedenkenlos lassen sich Würdenträger heute beim ersten Spatenstich für den Beginn grösserer Bauvorhaben fotografieren, obwohl Hitler und Konsorten mit demselben Ritual ihre Parteibauten initiierten. Grüne Ökologen stehen ebenso wenig im Verdacht brauner Kontamination wie die Bauernverbände und die so beliebten Gartenschauen. Im Gegensatz zu theoretischen Auseinandersetzungen und den daraus resultierenden Schaukämpfen zu meinem Projekt im Bundestag, ist der praktische Umgang mit Erde im Nachkriegsdeutschland unverkrampft. Niemand meint, die Zusammenführung von Erde aus Konzentrationslagern an zentralen Gedenkstätten sei ein nationalsozialistisches Ritual. Dasselbe galt 1995 für die zum Tag der Deutschen Einheit aus den Braunkohlenabbaugebieten von Cottbus und Garzweiler in Düsseldorf vereinigte Erde.
Nichts deutet darauf hin, dass die Abgeordneten, die sich Gedanken machen, von welchem Ort in ihrem Wahlkreis sie eine Erdprobe zur Mini-Bundesrepublik im Reichstagsgebäude bringen wollen, einem Blut-und-Boden Wahn verfallen seien. Der Boden der Wahlkreise ist nicht durch das Blut ihrer Bewohner oder das Blut, das da einmal in Schlachten vergossen sein mochte, determiniert. Wie ich mir erzählen liess, denkt die Justizministerin Däubler-Gmelin an Erde aus dem Umkreis von Carlo Schmid, einem der Väter des Grundgesetzes, also im fast buchstäblichen Sinne an “Verfassungserde.” In einem Interview sagte der Bundestagspräsident, er wolle aus seinem Kiez am Prenzlauer Berg Erde vom jüdischen Friedhof zum Platz der Republik nach Berlin-Mitte bringen. Der Solinger Abgeordnete Hans-Werner Bertl möchte, dass in seinem Sack unter anderem Erde von dem Haus der Familie Genc dabei ist, das von Neonazis wegen seiner türkischen Bewohner abgebrannt worden war. Eifelbauern haben Elke Leonhard bereits aus verschiedenen Tälern Vulkanerde nach Berlin auf den Weg gegeben. Wie der Trierische Volksfreund(!) berichtet, wurde die Erde vorher von Umweltschützern und einem Pastor gesegnet. Viele Abgeordnete wollen die Bevölkerung ihres Wahlkreises an der Auswahl der Orte beteiligen, durch die sie in Berlin vertreten sein möchten. Es würde also im doppelten Sinne eine partizipatorische Aktion. Ich bin gespannt, ob Norbert Lammert sein Wort hält. Er hatte bei einer Podiumsdiskussion in der Akademie der Künste angekündigt, wenn der Bundestag zugunsten meines Projektes stimmen würde, wäre er unter den ersten, die Erde zum Reichstagsgebäude brächten. Eines ist aber wohl sicher, der CSU-Geschäftsführer Peter Ramsauer wird, wie er vorsichtshalber schon im vergangenen Jahr angekündigt hat, eher Erde auf den Watzmann schleppen als nach Berlin. Vielleicht nähme Antje Vollmer eine Einladung des Traunsteiner Abgeordneten an, ihn bei einer solchen Gipfelbesteigung zu begleiten. Vor “Biokitsch” bräuchte sich die Grüne Theologin in der dünnen Höhenluft nicht zu fürchten.
Astrid Wege:
In einem Interview mit Jeanne Siegel äusserten Sie 1971, dass Informationen, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort eingesetzt, sehr viel Macht erhalten und die gesellschaftliche Struktur beeinflussen könnten. Kunst wird mithin als Motor der gesellschaftlichen Veränderung, als positiver Verstärker oder Resonanzkörper projiziert, wobei Sie bei der Wahl der Mittel häufig auf starke Symbole und Reizbegriffe setzen. Auch Ihr aktuelles Projekt im Berliner Reichstagsgebäude – ebenso wie Ihr Beitrag zur “Whitney Biennial” in New York – scheinen von der Überzeugung getragen zu sein, durch künstlerische Interventionen Kritik an gesellschaftspolitischen Entwicklungen artikulieren zu können. Insbesondere Ihre New Yorker Arbeit, die durch Ihr Statement im Katalog eine strukturelle Analogie zwischen der kulturpolitischen Haltung des New Yorker Bürgermeisters Rudolph Giuliani und der des Nationalsozialismus nahe legt, löste einen politischen Skandal aus. Vorgeworfen wurde Ihnen die Banalisierung des Holocaust. Auch wenn man diesen Vorwurf als unzulässsige Diffamierung Ihrer Person und Ihrer Arbeit ablehnen muss, stellt sich die Frage, inwieweit der Verweis auf die Kulturpolitik des Nationalsozialismus im Katalogtext nicht die Engführung der Rezeption Ihrer Whitney-Arbeit und die daran anschliessenden Polemiken möglicherweise mitprovozierte. Anders formuliert interessiert mich, wie Sie selbst das Zusammenspiel zwischen der Wahl der formalen Mittel, der von Ihnen in Begleittexten angebotenen Leseweisen und der anschliessenden Rezeption einschätzen, und wie Sie die jeweilige Wirkung Ihrer Arbeiten an den spezifischen Orten des Whitney Museums und des Reichstagsgebäudes beurteilen.
Hans Haacke:
Ich hatte meinen Text für den Whitney-Katalog geschrieben, bevor ich eine Idee für eine Arbeit entwickelt hatte. Mitte Oktober war der Redaktionsschluss. Ich entschied mich, auf zwei Ereignisse Bezug zu nehmen, die zum Kontext gehörten, in dem meine Arbeit stehen würde. Das eine war die ungewöhnlich krasse Präsenz von Intel Markenartikeln in der im Oktober laufenden Whitney Ausstellung “The American Century” (die Ausstellung war von Intel gesponsert). Das andere war der unglaubliche Angriff des New Yorker Bürgermeisters Rudolph Giuliani auf das Brooklyn Museum. Am 1. Oktober war im Brooklyn Museum die “Sensation” Ausstellung eröffnet worden, die vorher, ohne Aufsehen zu erregen, im Hamburger Bahnhof gelaufen war. Weil das Brooklyn Museum dem Verlangen des Bürgermeisters nicht nachgekommen war, ein Bild von Chris Ofili abzuhängen, hatte Giuliani den monatlichen Scheck der Stadt für das Museum von rund 500.000 Dollar storniert. Er hatte weiterhin angekündigt, er werde die Trustees des Museums ihres Amtes entheben und durch ein Board seiner Wahl ersetzten, und er werde dem Museum sein der Stadt New York gehörendes Gebäude wegnehmen. Giuliani behauptete, das Bild, das er selber nie persönlich gesehen hatte, sei “sick.” Es beleidige Katholiken. Deshalb sei er als Bürgermeister verpflichtet, dem Museum jede Unterstützung durch die öffentliche Hand zu entziehen.
Zum Verständnis der politischen Landschaft gehört, dass Giuliani sich um den vakanten Senatssitz des Staates New York bewirbt. Das strategische Ziel seiner Kampagne war, katholische Wählerstimmen zu gewinnen (Giulianis Rivalin ist Hillary Clinton). Dem Vorbild von Jesse Helms und anderen erzkonservativen amerikanischen Politikern folgend, die sowohl der zeitgenössischen Kunst wie einer offenen Gesellschaft den Kampf angesagt haben, argumentierte der Bürgermeister, Steuerzahler dürften nicht gezwungen werden, eine Kunst zu fördern, die sie ablehnen. In einem 1990 verabschiedeten Gesetz wird gleichsam das “gesunde Volksempfinden” als Kriterium (…”sensitive to the general standards of decency and respect for the diverse beliefs of the American public”) für die Vergabe von Fördergeldern durch das National Endowment for the Arts (NEA)eingeführt. Das von Giuliani und seinen Kampfgefährten benutzte denunziatorische Vokabular ähnelt verblüffend dem der nationalsozialistischen Kunstsäuberer. 1991 hatte Stephanie Barron, die Kuratorin des Los Angeles County Museums im Katalog zu ihrer Ausstellung über die “Entartete Kunst”-Ausstellung deshalb auf “Parallelen” zwischen den Angriffen auf das NEA und der Hetze hingewiesen, die in Deutschland 1937 zu der Münchner Schandausstellung geführt hatten.
In meinem Katalogtext für die Biennale folgte ich ihrem Beispiel: “…dem Bürgermeister zufolge gelten das First Amendment [Garantie der freien Meinungsäusserung] und die in der amerikanischen Verfassung verankerte Trennung von Staat und Kirche nicht für öffentliche Institutionen und Institutionen, die öffentliche Gelder erhalten. Er scheint die Meinung der Nazis zu teilen, die 1937 in München eine Ausstellung mit dem Titel “Entartete Kunst” organisiert hatten. An jedem der aus den deutschen Museen entfernten Werke war ein Schild angebracht “Bezahlt von den Steuergroschen des arbeitenden deutschen Volkes.” Was auch immer man von Charles Saatchi und seiner Sammlung in der “Sensation” Ausstellung im Brooklyn Museum halten mag – ich gehöre nicht zu den Bewunderern – für die USA war es ein wichtig, dass am 1. November ein Bundesgericht der Klage des Brooklyn Museums gegen Giuliani entsprach und ihn in scharfen Worten des Verfassungsbruches für schuldig befand. Die populistisch äusserst wirksam verbrämte Missachtung des First Amendment wurde schliesslich das Thema meiner Arbeit für die Whitney Biennnial.
Dass meine Reklamation der in der amerikanischen Verfassung garantierten Freiheit der Kunst als skandalös empfunden wurde, spricht Bände. Ebenso bemerkenswert war, dass das Museum sich gezwungen sah, sich wegen der Ausstellung meiner Arbeit zu verteidigen und der Direktor meinte, er müsse sich vorsichtig von ihr distanzieren. Dass die Giuliani-Wahlkampfstrategen von meiner Installation nicht erbaut sein würden, war mir natürlich klar. Ich wäre allerdings nie darauf gekommen, dass sie auf die raffinierte Idee kommen könnten, als Ablenkungsmanöver auszustreuen, ich trivialisiere den Holocaust. Damit war es ihnen gelungen, vom problematischen Verhältnis ihres Kandidaten zur Verfassung abzulenken, und stattdessen mich zum Thema zu machen und moralisch an den Pranger zu stellen. Ausserdem rechneten sie wohl, mit dieser Beschuldigung bei ungenau informierten jüdischen Wählern auf Stimmenfang gehen zu können. Für eine Weile verfing das. Auch in der deutschen Presse wurde dieses für politisch helle New Yorker recht durchsichtige Wahlkampfmanöver unbefragt weitergetragen. Dadurch wurde es sogar Teil der Debatte über mein Projekt für das Reichstagsgebäude.
Auf dem Katalogumschlag für die Ausstellung “The American Century” des Whitney Museums vom vergangenen Jahr prangt das Jasper Johns Bild “Three Flags” von 1958. Das Bild gehört dem Museum. In meiner Installation “Sanitation” für die Biennale habe das allgemein als amerikanische Ikone gehandelte Bild durch ein Ready-made aus drei in einem Fahnengeschäft erstandene amerikanische Fahnen unterschiedlicher Grösse ersetzt. Die kleinste in der Mitte droht, sich von der nächst Grösseren zu lösen und herabzufallen. Ein goldgerahmtes Faksimile des First Amendment, in der Wachsmalweise, mit der Jasper Johns seine Fahnen auf Zeitungspapier gemalt hatte – bei mir sind es New York Times Artikel zur Brooklyn Museum Kontroverse -, liegt auf dem Boden zwischen zwölf grauen Mülltonnen mit wie Mäuler geöffneten Deckeln. Aus jeder Tonne tönen, wenn man genau hinhört, Marschtritte. Die Marschierdenden scheinen im Begriff zu sein, den in feiner Kanzleikursivschrift ausgeführten Verfassungsartikel auf dem Boden niederzutrampeln. Politikersprüche in denen von der “Verschwendung von Steuergeldern” und von Kunst als “garbage,” der in Mülltonnen gehört, die Rede ist, flankieren in weisser Fraktur auf schwarzem Grund rechts und links die aus der Kunst in den Fahnenhandel “zurückgeholten” Stars and Stripes.
Die Besucher der Ausstellung “The American Century:” des vergangenen Jahres (ich war darin mit einer älteren Arbeit über New Yorker Immobilien vertreten) wurden in der Orientierungsgalerie im Erdgeschoss des Museums durch ein Videoband ins Thema der Ausstellung eingestimmt. Es war ein 3-minütiger Verschnitt der politischen und künstlerischen Ereignisse des Jahrhunderts. Am Ende las man weiss auf blauem Grund “MAKE SOME SENSE OF AMERICA. Diese Losung habe ich mir zu Herzen genommen. Entsprechend habe ich es auch in Berlin gehalten.