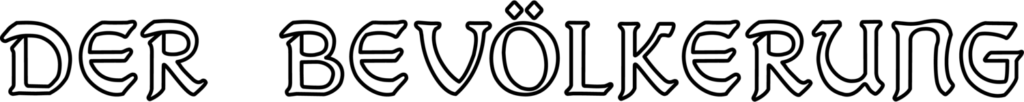Astrid Wege:
Die Bundestagsdebatte am 5. April, in der über die Realisierung Ihres Projektvorschlags für das Berliner Reichstagsgebäude abgestimmt wurde, bildet den vorläufigen Abschluss einer teilweise äusserst polemisch geführten Auseinandersetzung. Während die Gegner in jedem Element Ihrer Arbeit, das die Abgeordneten einlädt, jeweils einen Zentner Erde aus ihren Wahlkreisen oder Bundesländern in den Holztrog im nördlichen Lichthof zu bringen, Anklänge an die Blut- und Bodenmythologie des Nationalsozialismus sahen und die Leuchtschrift “Der Bevölkerung” als Verunglimpfung des parlamentarischen Auftrags ablehnten, der doch “Dem Deutschen Volke” gewidmet sei, verteidigen die Befürworter nicht nur die Freiheit der Kunst im Allgemeinen, sondern erkannten in Ihrem Vorschlag einen Denkanstoss, wie Staatsbürgerschaft und das “Deutsche” gegenwärtig (neu) definiert werden könnten. Unser Gespräch findet nach der knappen Mehrheitsentscheidung für Ihr Projekt statt, und ich sehe darin eine Chance. Einzelne Aspekte zu vertiefen, die in der Diskussion zwar erwähnt und für oder wider Ihr Projekt eingesetzt wurden – ohne jedoch in der Struktur der bisherigen Polarisierungen gefangen zu bleiben. Doch zunächst möchte ich mit der Frage beginnen, wie Sie selbst – mit einigem Abstand – die Plenumsdebatte im Deutschen Bundestag beurteilen?
Hans Haacke:
Nach drei Wochen fehlt mir wohl noch der nötige Abstand. Meine Antwort ist deshalb etwas unausgegoren. Ich habe die Debatte von der Tribüne aus verfolgt. Es war faszinierend. Dem Tagesordnungspunkt meines Projektes ging eine Kosovo Debatte voraus, in der unter anderen Joschka Fischer und der Verteidigungsminister sprachen. Das Plenum war spärlich besetzt. Viele der anwesenden Abgeordneten redeten miteinander oder lasen die Zeitung, und es wurde am Ende lustlos per Hammelsprung, also anonym, abgestimmt. Dann füllte sich der Saal. Möglicherweise spielte eine Rolle, dass die Abstimmung freigegeben war, das heisst, die Abgeordneten waren in ihrer Entscheidung über mein Projekt nicht an Parteidisziplin gebunden. Und es sollte namentlich abgestimmt werden. Jeder konnte und musste Farbe bekennen! Insgesamt gaben 549 Parlamentarier (von 669) ihre Stimme ab: 260 dafür, 258 dagegen, 31 enthielten sich der Stimme. Jede Partei, mit Ausnahme der PDS, schickte einen Fürsprecher und einen Gegner ans Rednerpult. Von der SPD nahmen ausser einer Gegnerin zwei Befürworter das Wort. Die PDS war nur durch einen Fürsprecher, den Abgeordneten Heinrich Fink, vertreten. Alle sprachen mit Leidenschaft. Es wurde gegrölt, gelacht, und es gab Buhrufe. Sicher haben die Fernsehkameras, die jede Regung aufzeichneten und per Phönix sogar simultan übertrugen, zur Dramatik der Veranstaltung beigesteuert. Wie zu erwarten, gab es kaum Argumente, die nicht bereits im Vorfeld ausgetauscht worden waren. Am spannendsten war für mich, zu beobachten, welchen Rednern von wem applaudiert wurde. Für Frau Süssmuth, die sich entschieden zugunsten meines Projektes aussprach, regte sich in ihrer eigenen Partei keine Hand. Dagegen erhielt sie regen Applaus aus allen anderen Parteien. Ähnlich ging es dem FDP-Abgeordneten Ulrich Heinrich, einem Landwirt, der als Mitglied des Kunstbeirats bereits für mein Projekt votiert hatte. Antje Vollmer, eine “Gegnerin der ersten Stunde,” erhielt frenetischen Beifall von der CDU/CSU, weniger stürmischen von ihren Parteikolleginnen und Kollegen. Letzten Endes schloss sich ihr bei der Abstimmung nur eine Minderheit der Fraktion an. Die meisten Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen folgten den Argumenten ihrer Berliner Kollegin Eichstädt-Bohlig, einer Architektin, und votierten für das Projekt. Die CDU/CSU stimmte als geschlossener Block dagegen. Keiner enthielt sich der Stimme. Es war für die in diesen Monaten so gebeutelte Fraktion eine seltene Gelegenheit, Einigkeit zu zeigen und die Partei bei rechten Wählern in Erinnerung zu rufen. Nur zwei CDU/CSU Abgeordnete scherten aus der Reihe: die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und die CSU-Abgeordnete Renate Blank, eine Geschäftsfrau aus Nürnberg. Beide sind – wie Herr Heinrich – Mitglieder des Kunstbeirates und hatten wie er mein Projekt von Anfang an befürwortet. In der FDP wurde es ausser von ihm nur vom Parteivorsitzenden Wolfgang Gerhardt und der ehemaligen Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger unterstützt. Wie Bündnis 90/Die Grünen war die SPD gespalten. Die überwiegende Mehrzahl der Genossen folgte dem Abgeordneten Gert Weisskirchen. Als energischer Verfechter des liberalisierten Staatsbürgerschaftrechts und der Offenheit gegenüber zeitgenössischer Kunst engagierte er sich leidenschaftlich für mein Projekt. Und die Genossen nahmen sich die warnende Schlussrede des Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse zu Herzen. Es gab in der SPD aber auch eine nicht unbedeutende Zahl von Stimmenthaltungen und ein paar Gegenstimmen. Vor der Auszählung hatte ich den Eindruck, mein Projekt würde nicht überleben. Einhellig wird angenommen, der CDU-Abgeordnete Volker Kauder habe es in letzter Minute gerettet. Seine Rede war derart ausfallend und deutschnational, dass Abgeordnete, die bis dahin geneigt waren, negativ zu stimmen oder sich der Stimme zu enthalten, von seiner schrillen Tonart so abgestossen waren, dass sie umgeschwenkt sind. Ein klassisches Eigentor. Im November war der Abgeordnete des Wahlkreises Rottweil – Tuttlingen bei der 9:1 Abstimmung im Kunstbeirat der Einzige gewesen, der aufgeregt gegen meinen Entwurf gestimmt hatte und dann – zusammen mit Antje Vollmer, die die Abstimmung verpasst hatte – nicht bereit war, das Abstimmungsergebnis demokratischen Gepflogenheiten entsprechend zu akzeptieren. Unmittelbar nach dem Kunstbeiratsvotum hatte Kauder in der FAZ eine wütende Kampagne gegen den Kunstbeirat und mein Projekt angezettelt und ihm damit die inzwischen bis zum Überdruss reichende Publizität verschafft. Treu flankierte ihn dabei die grüne Antje Vollmer. Die Aufregung kulminierte schliesslich in der für die Opposition letzten Endes desaströsen Bundestagsdebatte. Ähnlich soll seinerzeit im Bundestag eine Brandrede von Wolfgang Schäuble zur nicht erwarteten Annahme der Reichstagsverpackung von Christo und Jeanne-Claude gesorgt haben.
Astrid Wege:
Ein zentraler Begriff, auf den sich beide Lager wiederholt berufen haben, ist der der Freiheit: Freiheit zum einen als verfassungsrechtlich garantierte Freiheit der Kunst auf Seiten der Verteidiger, die in der nachträglich herbeigeführten Plenumssitzung einen Präzedenzfall sahen, der die vielbeschworene Freiheit der Kunst auf fatale Weise in Mehrheitsentscheidungen umdefinieren würde, zum anderen als die von einigen Gegnern Ihres Projekts beschworene Freiheit des einzelnen Abgeordneten, sich aus der vermeintlichen Bevormundung durch die künstlerische Arbeit und dem angeblichen Meinungsmonopol der Kunstexperten zu lösen – wobei zumindest nicht nur die Freiwilligkeit des partizipatorischen Moments Ihrer Arbeit ignoriert wurde, sondern auch die Tatsache, dass eine Ablehnung durch das Parlament über eine rein persönliche Abstimmung hinaus natürlich einen repräsentativen Ausschluss vornehmen würde: Eine Formulierung wie die Volker Kauders, der – nachdem ein von ihm vorgestelltes Gutachten über die vermeintliche “Verfassungswidrigkeit” Ihrer Arbeit nicht gegriffen hatte – bemerkte, Sie könnten die Arbeit ja “überall in Berlin aufstellen…nur nicht im Reichstag,” täuscht darüber hinweg, dass es bei der Auswahl der Kunstprojekte im Reichstagsgebäude um nichts weniger geht als um ein repräsentatives Bild deutscher Geschichte und den Ausweis von Weltoffenheit und Fortschrittlichkeit. Eingeladen waren “international anerkannte Künstlerpersönlichkeiten aus den Ländern der ehemaligen Vier Alliierten,” die sich “besonders mit deutscher Geschichte oder allgemein mit Erinnerungsarbeit auseinandergesetzt haben.” So zumindest hiess es in einer Presseerklärung zu den Direktvergaben für den Reichstag 1998. Ohne hier im Einzelnen auf die Diskussionswürdigkeit einer solchen Repräsentationsfunktion von Kunst eingehen zu können, wird jede künstlerische Arbeit in diesem Kontext, ob beabsichtigt oder nicht, Teil dieser Zuschreibung, selbst wenn sie, wie die Ihre, so heftige Abwehrreaktionen hervorruft. Der ohnehin schon ambivalente Begriff künstlerischer Autonomie, den Sie in Ihren Arbeiten ja wiederholt in Frage gestellt haben, erfährt an einem Ort wie dem Reichstagsgebäude nochmals eine weitere Wendung. Ihr Projekt wird nach dieser Debatte auch als Aushängeschild parlamentarischer Toleranz fungieren – ein Mechanismus, der bereits in den zahlreichen Bezugnahmen auf Christo und Jeanne-Claude während der Debatte deutlich wurde, deren Projekt damals nur mit knapper Mehrheit verabschiedet wurde, nun aber als positiver Referenzpunkt vor allem von den Gegnern Ihre Projekts in Anspruch genommen wurde. Weiterhin interessiert mich in diesem Zusammenhang, inwieweit Sie ihr Projekt als Ergänzung oder Korrektiv zu den anderen Projekten im Reichstagsgebäude konzipiert haben – Sie haben Ihren Vorschlag ja erst relativ spät nach der Einladung durch den Kunstbeirat eingereicht, kannten also die meisten Projekte Ihrer Kollegen, die, wenn sie sich nicht von vornherein auf den Standpunkt einer rein formalen Präsenz zurückgezogen haben, ambivalent auf die Geschichte des Ortes und den damit verbundenen Auftrag reagierten.
Hans Haacke:
Ich war einer der letzten Künstler, die eingeladen wurden. Das war im Mai 1998. Im Frühjahr 1999 war ich mit meinem Entwurf und der Aushandlung eines Vertrages mit der zuständigen Bundesbaugesellschaft so weit, dass ich dem Kunstbeirat einen Entwurf präsentieren konnte. Dazu ist es schliesslich erst im September gekommen. In einer zweiten Sitzung hat der Kunstbeirat dann am 2. November seiner Realisierung zugestimmt (eine Entscheidung, die er am 25. Januar 2000 bekräftigte). Zur Zeit als sich meine Überlegungen präzisierten, kannte ich die meisten Arbeiten meiner Kollegen nur vom Hörensagen. Ich nehme auf den viel weiter gespannten gesellschaftlichen Kontext der deutschen Geschichte und – ortsspezifisch – der Rolle des Parlaments in der Gegenwart und Zukunft Bezug. Das war von den eingeladenen Künstlers ausdrücklich erwünscht. Unsere Arbeiten erfüllen an diesem Ort, wie Sie richtig sagen, eine Repräsentationsrolle. Eben deshalb ist über sie, besonders im Falle meines Projektes, so erbittert gestritten worden. In der entscheidenden Sitzung des Kunstbeirates vom 2. November hatte sich Herr Kauder empört, mein Projekt sei ein unzulässiger “Paradigmenwechsel,” ein Terminus, der wenige Tage später wutschnaubende von dem CDU-nahen Journalisten Karl Feldmeyer in der FAZ aufgegriffen wurde. Die rechte Wochenzeitung Junge Freiheit pustete aufgebracht in dasselbe Horn. Herr Kauder sorgte ausserdem in seiner Nachbarstadt Freiburg für die Erstellung eines kritischen “Verfassungsgutachtens.” Die Anrufung des Grundgesetzes demonstriert zwar nicht, dass die verfassungsmässig vorgeschriebene Funktion des Parlaments bedroht war, wohl aber dass das parlamentarische Selbstverständnis einiger Bundestagsabgeordneter zur Debatte stand. Im Kontrast zum Abgeordneten Weisskirchen konnte man auf der Website von Herrn Kauder bis vor kurzem eine durch die inzwischen erfolgte Gesetzgebung überholte Polemik gegen die Novellierung des Staatsbürgerschaftsrechtes anklicken.
Ein wesentliches Thema der Debatte war das Verhältnis des Bundestages zur “Freiheit der Kunst.” Im Grundgesetz ist sie garantiert. Es kann demnach in der Bundesrepublik und damit natürlich auch am Parlamentssitz keine verfassungswidrigen Kunstwerke geben. Im vorliegenden Falle hatte der Bundestag als Auftraggeber – absolut legitim – das Recht, einen künstlerischen Entwurf für das Reichstagsgebäude anzunehmen oder seine Realisierung abzulehnen. Gebrannt durch üble Erfahrungen mit dem “gesunden Volksempfinden” und der Geschichte der DDR, an die Wolfgang Thierse in seiner Rede warnend erinnerte, hatte sich der Ältestenrat des Bundestags schon vor Jahren den Kunstbeirat geschaffen, ein zwölfköpfiges, im Parteienproporz besetztes Gremium kunstineressierter Abgeordnete, die, beraten durch namhafte Kunstexperten , den Bundestag quasi vor sich selber, das heisst vor potentiellen populistischen Strömungen in den eigenen Reihen schützen sollte. Da die Herbeiführung von Erde aus den Wahlkreisen freiwillig ist (wie hätte ich die Abgeordneten denn zwingen können, wenn ich das gewollt hätte?), gab es keine Notwendigkeit, über diesen Aspekt meines Entwurfes abzustimmen. Wenn das Votum negativ ausgegangen wäre, dann wäre der Kunstbeirat desavouiert und sein Überleben als sachverständiger Puffer in Frage gestellt worden. Ein solcher Ausgang hätte möglicherweise auch als Signal verstanden werden können, es sei für eine demokratische Gesellschaft normal und diene dem Wohl der Kunst, wenn über Ausstellungen, Aufträge und Ankäufe von Kunstwerken allgemein in Vollversammlungen abgestimmt würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Procedere zu leicht verdaulicher Ware führen würde, ist allen, die sich im Milieu ein bisschen auskennen, bewusst. Aus Furcht vor einer solchen Entwicklung erinnerte der SPD-Abgeordnete Weisskirchen daran: “Vor allen Wahlen und Abstimmungen beruht Demokratie… darauf, anzuerkennen, dass es nicht Abstimmbares gibt. Bislang galt bei uns die Überzeugung und der Konsens, dass über Kunst nicht abgestimmt werden kann.” Er schloss damit an die Rede “Demokratie als Bauherr” an, die der ehemalige, allseits respektierte SPD-Bundestagsabgeordnete Adolf Arndt 1961 zum Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Demokratie gehalten hatte. Die Diskussion über dieses Spannungsverhältnis ist vertrackt, weil einerseits natürlich die Notwendigkeit besteht, auch im Künstlerischen Entscheidungen zu fällen, andererseits aber klar ist, dass Fachgremien sich nicht allein durch ein utopisches, “interesseloses Wohlgefallen” leiten lassen. Kunstsachverständige und Künstler sind durch ihren persönlichen und institutionellen Habitus – manchmal auch durch “Sachzwänge” – geprägt, d.h. sie sind auch nur Menschen. Man sollte jedoch als warnende Beispiele aus der Gegenwart die im U.S. Congress gegenüber dem National Endowment for the Arts und von dem für einen Senatssitz kandidierenden New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani wahlstrategisch motivierte Repression nicht aus dem Auge verlieren. Dass künstlerische Ermesssensfragen bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen zum Wahlkampfthema werden könnten, haben unter anderem bei der Terminierung der Bundestagsdebatte zu meinem Projekt ein Rolle gespielt. Der Abgeordnete Norbert Lammert, CDU-Sprecher für Kunst und Medien und Koordinator des Gruppenantrages zu seiner Ablehnung stammt aus Bochum. Sein Landesvorsitzender Jürgen Rüttgers hatte sich mit dem Reim “Kinder statt Inder” gerade als Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen einen Namen gemacht. Wir fahren mit Sachverständigen, solange sie nicht als politische Handlanger fungieren, wahrscheinlich grosso modo besser als mit dem “gesunden Volksempfinden.”
Ich zögere, das Abstimmungsergebnis als Zeichen von Toleranz zu verstehen. Wenn ich das täte, würde ich alle, die mein Projekt nicht unterstützt haben, über einen Kamm scheren und implizit für intolerant erklären. Das wäre falsch. Die Gemengelage war zu komplex. Allerdings gab es von der Opposition Äusserungen, deren Wortwahl und Stossrichtung gegenüber zeitgenössischer Kunst ein erschreckendes Mass an Intoleranz demonstrierten. Es zeigte sich auch, dass eine beträchtliche Zahl der Abgeordneten anscheinend Schwierigkeiten haben, sich mit dem Artikel 3 des Grundgesetzes anzufreunden. Die Knappheit des Votums lässt nicht zu, es gegenwärtig als “Aushängeschild” für eine fraktionsübergreifende Toleranz des Bundestags zu benutzen. Aber das könnte sich ändern.
Astrid Wege:
Ihre Arbeit für das Reichstagsgebäude lässt sich als ein Porträt des parlamentarischen Systems, seiner relativen Abgeschlossenheit und seiner Veränderungsprozesse lesen, versinnbildlicht in dem Zusammentreffen der verschiedenen Erdzentner und dem wildwachsenden und nicht gärtnerisch manipulierten Wuchern der pflanzen, ergänzt zudem durch die tafeln mit den Namen der Abgeordneten, ihrer Parteizugehörigkeit, den Wahlkreisen oder Bundesländern, die sie vertreten, und durch eine Website, die regelmässig aufgezeichnete Aufnahmen einer Videokamera der Öffentlichkeit zugänglich macht. Dieser Ansatz knüpft in gewisser weise an Ihre frühen systemischen Arbeiten an, die ein komplexes Wechselspiel zwischen relativer Abgeschlossenheit und Ausseneinflüssen darstellten, und überträgt den Gedanken der Entropie auf die letztlich nicht vollständig kalkulierbaren Prozesse und Vorgänge parlamentarischer Arbeit.
Wiederholt wurde gegen den Vorwurf der “Blut-und-Boden”-Metaphorik eingewendet, dass der Wildwuchs der Pflanzen und seine Nichtplanbarkeit der Ideologie des Nationalsozialismus widerspreche. Sie selbst haben in einer Replik auf einen Artikel von Martin Warnke, in dem er sein Unbehagen gegenüber der Erdausschüttung artikulierte, betont, dass man dem Nationalsozialismus nicht einen zweiten Sieg feiern lassen dürfe, indem man ihm die Bedeutungshoheit über das Material Erde überliesse. Künstlerische Arbeit wird also als eine Wiederaneignung, Bedeutungsverschiebung und Neubesetzung dieses Materials begriffen, als Strategie, die sich gezielt an die Grenzen klischierter, stereotyper Vorstellungen, wie hier, Tabus begibt und damit, zumal an diesem speziellen historischen Ort, keineswegs so “unschuldig” sein kann, wie es sich mir zum Teil in Ihren Äusserungen darstellte.
Wenn Sie in dem zumindest in Deutschland zwiespältig konnotierten Erdschüttritual die Möglichkeit einer Umdrehung sehen, wieso gestehen Sie dem Begriff des Volkes nicht ein ähnliches Potential der Bedeutungsverschiebung zu? Zumal der Transfer des Brechtzitats, das im Exil unter dem unmittelbaren Eindruck des Nationalsozialismus entstand, seinerseits ja bereits eine Bedeutungsverschiebung impliziert, wenn man ihn auf die heutige Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft anwendet? … weiter